Kurz & knapp: Günstigkeitsprinzip
Das Günstigkeitsprinzip besagt, dass immer die günstigere Regelung für den Arbeitnehmer gilt. Wenn der Tarifvertrag 30 Urlaubstage und der Arbeitsvertrag nur 25 Urlaubstage bietet, gilt die günstigere Regelung aus dem Tarifvertrag. Das Rangprinzip hingegen besagt, dass übergeordnete Rechtsquellen Vorrang vor niedrigeren haben.
Das Günstigkeitsprinzip greift nicht, wenn die zu vergleichenden Regelungen keine sachlichen Zusammenhänge aufweisen oder wenn die höherrangige Norm keine günstigere Abweichung erlaubt. Näheres dazu können Sie in diesem Abschnitt finden.
In der Praxis erfolgt die Anwendung des Günstigkeitsprinzips durch einen Vergleich der Regelungen. Nur Regelungen mit sachlichem Zusammenhang, wie Kündigungsfristen oder Urlaubsansprüche, werden verglichen.
Inhalt
Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht: Definition und Inhalt

Was ist das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht? Einfach erklärt, handelt es sich dabei um eine grundlegende Regel, die bei der Kollision verschiedener Regelungen zugunsten des Arbeitnehmers entscheidet. Wenn mehrere Regelungen auf ein Arbeitsverhältnis anwendbar sind, ist die Regel anzuwenden, die für den Arbeitnehmer die günstigeren Bedingungen bietet. Dieses Prinzip ist besonders wichtig, um den Schutz der Arbeitnehmer zu gewährleisten und ihre Rechte zu stärken.
Das Günstigkeitsprinzip ist im Gesetz nicht explizit verankert, sondern ergibt sich aus der Rechtsprechung und der Auslegung des Arbeitsrechts. In der Praxis wird das Günstigkeitsprinzip häufig durch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und anderer Gerichte konkretisiert.
Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag: Reihenfolge im Günstigkeitsprinzip
Das Günstigkeitsprinzip kann im Arbeitsrecht mithilfe einer Pyramide veranschaulicht werden, die die Hierarchie der verschiedenen Rechtsquellen darstellt. Diese Hierarchie bestimmt, welche Regelung Vorrang hat, wenn mehrere Vorschriften auf ein Arbeitsverhältnis anwendbar sind. Beim Günstigkeitsprinzip sieht dies wie folgt aus:
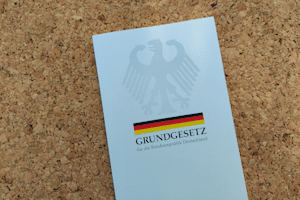
- EU-Recht: Diese Regelungen haben Vorrang vor nationalem Recht und müssen von allen Mitgliedstaaten eingehalten werden.
- Grundgesetz: Als Verfassung der Bundesrepublik Deutschland steht das Grundgesetz an oberster Stelle der nationalen Rechtsordnung.
- Gesetze des Bundes: Bundesgesetze sind zum Beispiel das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) oder das Arbeitsschutzgesetz.
- Gesetze des Landes: Landesgesetze gelten nur im jeweiligen Bundesland und müssen mit Bundesrecht vereinbar sein.
- Verordnungen: Rechtsverordnungen konkretisieren Gesetze und werden von der Exekutive erlassen.
- Tarifvertrag: Tarifverträge können für bestimmte Branchen oder Unternehmen verbindliche Regelungen festlegen, die über die gesetzlichen Mindeststandards hinausgehen.
- Betriebsvereinbarung: Betriebsvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Betriebsrat, die für alle Arbeitnehmer eines Betriebs gelten.
- Arbeitsvertrag: Der Arbeitsvertrag regelt die individuellen Arbeitsbedingungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Das Günstigkeitsprinzip bei einer Betriebsvereinbarung kommt ins Spiel, wenn diese mit individuellen arbeitsvertraglichen Regelungen kollidiert. In solchen Fällen setzt sich die für den Arbeitnehmer günstigere Regelung durch. Dies bedeutet, dass ein Arbeitnehmer sich auf eine vorteilhaftere Regelung in seinem Arbeitsvertrag berufen kann, auch wenn die Betriebsvereinbarung etwas anderes vorsieht.
Um festzustellen, welche der konkurrierenden Regelungen die für den Arbeitnehmer günstigeren Bedingungen enthält, kann ein Günstigkeitsvergleich herangezogen werden. Dabei wird ein objektiver Beurteilungsmaßstab verwendet. Es dürfen nur Regelungen verglichen werden, die in einem sachlichen Zusammenhang stehen, wie zum Beispiel Regelungen zur Arbeitszeit im Arbeitsvertrag und in der Betriebsvereinbarung oder zur Vergütung im Tarifvertrag und in der Betriebsvereinbarung
Kündigungsfrist im Günstigkeitsprinzip: Arbeitsvertrag & Tarifvertrag nicht immer ausschlaggebend

Ein häufiger Fall für das Günstigkeitsprinzip im Arbeitsrecht ist die Kündigungsfrist. Wenn ein Arbeitsvertrag eine kürzere Kündigungsfrist vorsieht als der Tarifvertrag oder das Gesetz, gilt die kürzere Frist, da sie für den Arbeitnehmer vorteilhafter ist, wenn dieser selbst kündigen möchte. So ist sichergestellt, dass Arbeitnehmer nicht durch längere Kündigungsfristen benachteiligt werden.
Angenommen, ein Tarifvertrag sieht eine Kündigungsfrist von vier Wochen vor. Ein Arbeitnehmer hat jedoch in seinem Arbeitsvertrag eine Kündigungsfrist von zwei Monaten vereinbart. In diesem Fall gilt durch das Günstigkeitsprinzip die längere Kündigungsfrist von zwei Monaten, da sie günstiger für den Arbeitnehmer ist.
Urlaubsregelungen fallen ebenfalls unter das Günstigkeitsprinzip
Auch bei Reglungen zum Urlaub kann das Günstigkeitsprinzip greifen. Wenn ein Arbeitsvertrag mehr Urlaubstage als der Tarifvertrag oder das Gesetz vorsieht, gilt die Regelung des Arbeitsvertrags. Dies ermöglicht es Arbeitnehmern, von besseren Urlaubsbedingungen zu profitieren, die individuell ausgehandelt wurden.
Ein Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat einen Arbeitsvertrag, der ihm 30 Urlaubstage pro Jahr gewährt. Der Tarifvertrag für seine Branche sieht jedoch nur 24 Urlaubstage vor. Demnach folgt bei diesem Beispiel aus dem Günstigkeitsprinzip, dass der Urlaub 30 Jahre betragen muss, da dies die günstigere Regelung ist.
Sind auch kürzere Arbeitszeiten für Arbeitnehmer möglich?
Das Günstigkeitsprinzip bei der Arbeitszeit kann ebenfalls zur Anwendung kommen. Wenn ein Arbeitsvertrag flexiblere oder kürzere Arbeitszeiten als der Tarifvertrag bietet, wird diese Regelung bevorzugt. Dies ist besonders vorteilhaft für Arbeitnehmer, die eine bessere Work-Life-Balance anstreben.
Auch in anderen Bereichen ist das Günstigkeitsprinzip möglich, zum Beispiel bei der Regelung von Fortbildungsmaßnahmen, der Überstundenvergütung oder der Regelung von Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld. In jedem dieser Fälle wird die Regelung angewendet, die für den Arbeitnehmer die günstigeren Bedingungen bietet.
Ist ein Ausschluss des Günstigkeitsprinzips möglich?
Vorsicht! Grundsätzlich ist ein Ausschluss möglich. Das Günstigkeitsprinzip kann im Arbeitsvertrag oder der Betriebsvereinbarung aufgehoben werden. Achten Sie daher vor Unterzeichnung des Vertrages auf folgende Aspekte, um Nachteile durch den Ausschluss zu vermeiden:

- Ausdrückliche Vereinbarung: Der Ausschluss des Günstigkeitsprinzips muss im Arbeitsvertrag klar und eindeutig formuliert sein.
- AGB-Kontrolle: Da es sich um eine für den Arbeitnehmer nachteilige Klausel handelt, unterliegt sie der Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) und muss insbesondere transparent sein.
- Betriebsvereinbarungsoffenheit: Ein Arbeitsvertrag kann grundsätzlich eine Klausel enthalten, die Betriebsvereinbarungen auch zu Ungunsten des Arbeitnehmers zulässt. Allerdings ist das Günstigkeitsprinzip ein fundamentales Schutzprinzip, das nicht einfach ausgehebelt werden kann. Um Rechtssicherheit zu gewährleisten, empfiehlt es sich, eine klare Regelung zur Betriebsvereinbarungsoffenheit im Arbeitsvertrag zu formulieren.
Das Günstigkeitsprinzip ist nicht anwendbar, wenn die zu vergleichenden Regelungen keine sachlichen Zusammenhänge aufweisen oder wenn die höherrangige Norm keine günstigere Abweichung erlaubt. Wenn ein Gesetz zwingende Mindeststandards festlegt, kann davon im Tarifvertrag nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers abgewichen werden.
Ein konkretes Beispiel ist das Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) in Deutschland. Nach diesem Gesetz haben Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf mindestens 24 Werktage Urlaub pro Jahr. Ein Tarifvertrag könnte jedoch eine größere Anzahl an Urlaubstagen festlegen, beispielsweise 30 Tage. In diesem Fall sind die 24 Urlaubstage des Gesetzes die „zwingenden Mindeststandards“. Ein Tarifvertrag könnte also für den Arbeitnehmer günstigere Bedingungen bieten (mehr Urlaub), aber nicht weniger als 24 Tage Urlaub festlegen.
Was wären für Arbeitnehmer die Folgen einer Abschaffung? Ohne das Günstigkeitsprinzip könnten Arbeitgeber leichter ungünstigere Arbeitsbedingungen durchsetzen, da die Schutzfunktion des Arbeitsrechts geschwächt wäre. Arbeitnehmer könnten gezwungen sein, schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, was ihre Verhandlungsposition erheblich schwächen würde.



Kommentar hinterlassen