Key Facts
- Mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung lassen sich Gefahrenquellen erkennen und dokumentieren.
- Gefährdungen können in verschiedene Kategorien eingeteilt werden (bspw. um sie ihrem Gefahrengrad nach zu bewerten).
- In jedem Beruf legen Gefährdungsbeurteilungen ihr Augenmerk in der Regel auf unterschiedliche Kriterien.
Rechtsgrundlage der Gefährdungsbeurteilung – Definition & Bedeutung

Inhalt
Worum genau handelt es sich bei einer Gefährdungsbeurteilung? Nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) lässt sich diese grundsätzlich als ein methodisches Verfahren zur Beurteilung von Gefahrenpotenzialen am Arbeitsplatz verstehen.
Das bedeutet, dass der Arbeitgeber gemäß § 5 Abs. 1 des ArbSchG herausfinden muss, welche potenziellen Gefährdungsquellen es in seinem Unternehmen gibt, damit entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen gegen diese vorgenommen werden können.
Wichtig: Allerdings müssen Beurteilungen nach § 5 Abs. 2 nur tätigkeitsweise durchgeführt werden (d. h. wenn mehrere Arbeitnehmer im Unternehmen die gleiche Tätigkeit ausführen, ist nicht für jeden eine Einschätzung erforderlich, sondern nur eine für alle gleichen Arbeitsplätze).
Aus welchen Situationen heraus laut dem Gesetzgeber bspw. eine Gefahr entstehen kann, die dann mithilfe einer Beurteilung entsprechend erfasst werden muss, ergibt sich aus § 5 Abs. 3:

- die Beschaffenheit und Ausstattung des Arbeitsplatzes bzw. der Arbeitsstätte (ungeeignete Tische und Stühle, rutschige Böden, fehlende Treppengeländer etc.)
- welche Arbeitsmittel vorhanden sind und genutzt werden (ungesicherte Werkzeuge und Geräte etc.)
- etwaige Beeinträchtigungen auf physikalischer, chemischer oder biologischer Ebene (Lärm, Chemikalien, Viren, Schimmelpilze etc.)
- die Gestaltung der Arbeitszeit und angewendeter Verfahren (unsichere oder ineffiziente Arbeitsabläufe, pausenlose Arbeitszeiten etc.)
- fehlende bzw. ungenügende Qualifikation oder Anleitung der Arbeitnehmer (potenzielle Unfälle etc.)
- psychische Beeinträchtigungen (hohe Stressbelastung, soziale Konflikte unter den Mitarbeitern oder mit dem Arbeitgeber etc.)
Wichtig: Ist die Durchführung für jeden Arbeitgeber verpflichtend? Ja, dass es für die Gefährdungsbeurteilung eine allgemeingültige Pflicht gibt, ist bereits seit dem Jahr 1997 im Arbeitsschutzgesetz festgelegt. Andernfalls würden einige Arbeitgeber mitunter keine Beurteilungen veranlassen und so die Sicherheit ihrer Mitarbeiter gefährden. Das hätte besonders in gefährlicheren Berufsfeldern (bspw. in der Chemieindustrie) zur Folge, dass schwere bis tödliche Verletzungen provoziert werden.
Die Verpflichtung, neben physischen Risikofaktoren auch die psychische Belastung zur Gefährdungsbeurteilung heranzuziehen, besteht hingegen seit 2013. Hier stehen nicht nur die Arbeitszeit, -umgebung oder -intensität im Vordergrund, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen und Konflikte.
Weiterführende Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung
Ablauf der Gefährdungsbeurteilung: Welche 7 Schritte gibt es?

Bei der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung empfiehlt es sich grundsätzlich, den folgenden 7 Schritten nach vorzugehen:
- 1.) Festlegung der zu prüfenden Arbeitsbereiche und Tätigkeiten: Zu Beginn muss der Arbeitgeber zunächst die Räumlichkeiten des Unternehmens in konkrete Bereiche und Arbeitsplätze unterteilen. So lässt sich gezielter überprüfen, welche Gefahrenpotenziale es jeweils gibt. Allgemeine Voraussetzungen (bspw. zur Beleuchtung, zum Brandschutz oder zu anderen Richtlinien, die betriebsintern überall gelten) können allerdings für alle Bereiche übergreifend ermittelt werden.
- 2.) Ermittlung potenzieller Gefährdungen: Dann muss der Arbeitgeber bestimmen, welche Gefahrenherde es grundsätzlich gibt. Dies kann er z. B. mithilfe von Befragungen des Personals, Prozessanalysen oder Begehungen entsprechender Bereiche vor Ort herausfinden. Die Überprüfung genutzter Arbeitsmittel oder die Analyse vergangener Unfälle bieten sich ebenfalls an.
- 3.) Beurteilung der ermittelten Gefährdungen: Konnte eine erste Gefährdungsbeurteilung potenzielle Gefahrenquellen identifizieren, muss im nächsten Schritt eingeschätzt werden, welches Risiko sie denn tatsächlich darstellen.
Hierfür ist bspw. eine Unterteilung in verschiedene Kategorien sinnvoll, die sich aus dem jeweiligen Gefährdungsrisiko ergeben.
- Grün: Der Arbeitgeber hat keinen dringenden Bedarf, zu handeln. Es besteht nur ein geringes Risiko, dass Belastungen gesundheitsschädigend sind oder Gefahren häufiger auftreten könnten.
- Gelb: Es gibt Handlungsbedarf, allerdings nur mittelfristig. Potenzielle Gefahren oder Belastungen sollten auf langfristige Sicht adressiert werden, lassen sich aber tolerieren, bis eine Problemlösung vorliegt (solange entsprechende Vorsicht geboten ist).
- Rot: Es muss sofort gehandelt werden, weil eine Gefährdung sehr wahrscheinlich ist bzw. etwaige Belastungen die Gesundheit aller schwer beeinträchtigen. Wenn es sich nicht anderweitig lösen lässt, ist es mitunter erforderlich, dass die Arbeit am betroffenen Arbeitsplatz bis auf weiteres eingestellt wird.
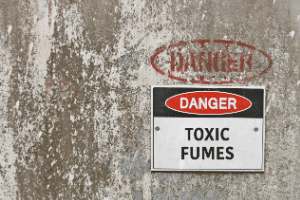
- 4.) Festlegung von passenden Schutzmaßnahmen: Nun muss sich der Arbeitgeber entscheiden, welche Handlungen er konkret vornehmen möchte, um gegen die jeweiligen Gefahrenherde vorzugehen.
- personengebundene Maßnahmen (Schutzkleidung, schützende Ausrüstung für Mitarbeiter etc.)
- technische Maßnahmen (Vorrichtungen, um die Gefahrenquelle unzugänglich zu machen oder anderweitig von den Mitarbeitern zu isolieren)
- organisatorische Maßnahmen (Anpassungen an Arbeitszeiten, interne Abläufe etc., um den Kontakt mit Gefahrenquellen möglichst auf ein Minimum zu reduzieren)
- 5.) Umsetzung festgelegter Schutzmaßnahmen: Hat der Arbeitgeber Maßnahmen beschlossen, muss er diese anschließend auch im Unternehmen realisieren. Das lässt sich am effizientesten bewerkstelligen, wenn das an der Umsetzung beteiligte Personal über seine Zuständigkeiten Bescheid weiß – sowohl auf der Führungs- als auch auf der Mitarbeiterebene. Sind etwaige Schulungen erforderlich, sollten diese ebenfalls angekündigt und zeitnah durchgeführt werden.
- 6.) Prüfung der Wirksamkeit aller umgesetzten Schutzmaßnahmen: Eine gewisse Zeit nach der Gefährdungsbeurteilung sollte überprüft werden, inwiefern die Maßnahmen ihren Zweck tatsächlich erfüllen. Das bedeutet, der Arbeitgeber muss zum einen bewerten, ob sich alle an diese halten und alles richtig umgesetzt wurde. Zum anderen ist es wichtig, dass er auch prüft, ob die Maßnahmen mitunter für neue Belastungen oder Gefährdungen gesorgt haben.
- 7.) Fortschreibung/Anpassung der Gefährdungsbeurteilung an neue Umstände: Zuletzt ist es ratsam, die Beurteilung nicht nur einmal durchzuführen, sondern in regelmäßigen zeitlichen Abständen zu wiederholen.
Wichtig: Wiederholt Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, ist deshalb sinnvoll, weil nicht nur die umgesetzten Maßnahmen an sich für neue Problematiken sorgen können. Auch externe Faktoren (Gesetzesänderungen und neue Vorschriften, Sanierungen, neue Arbeitsmaterialien etc.) sind mitunter ein Grund dafür, warum eine etwaige Maßnahme erneut überdacht werden muss.
Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz – Beispiele im Vergleich
Belastungen und Gefahren sind auf der Arbeit keine Seltenheit, aber sie fallen nicht überall gleich aus und kommen unterschiedlich zum Vorschein. Eine Gefährdungsbeurteilung für Baustellen oder Maschinen unterscheidet sich also von denen, die in anderen Branchen durchgeführt werden. Der Arbeitgeber muss somit fallspezifische Maßnahmen treffen.
Die folgende Übersicht stellt für Sie dar, welche Kriterien gemäß § 5 Abs. 3 des ArbSchG in verschiedenen Bereichen berücksichtigt werden und warum eine Gefährdungsbeurteilung im Büro auf den Arbeitsplatz bezogen eine andere ist, als bspw. bei der Feuerwehr:
1.) = Arbeitsstätte bzw. Arbeitsplatz
2.) = äußere Beeinträchtigungen
3.) = Arbeitsmittel
4.) = Arbeitszeit und Arbeitsabläufe
5.) = mangelnde Qualifikation/Einweisung
6.) = psychische Beeinträchtigungen
| Gefährdungsbeurteilung in einem Büro 🧑💼🏢 | Gefährdungsbeurteilung bei der Feuerwehr 🧑🚒🚒 | Gefährdungsbeurteilung auf der Baustelle 👷🏗️ |
|---|---|---|
| 1.) ⚠️Rückenschmerzen durch Schreibtischstühle ohne Höhenverstellfunktion | 1.) ⚠️Zeitverlust durch blockierte Notfallwege in der Feuerwache | 1.) ⚠️Sturzgefahr aufgrund fehlender Treppengeländer oder Baugerüste |
| 2.) ⚠️Stress durch dauerhafte Lärmbelastung (Telefonate, Meetings, Drucker etc.) | 2.) ⚠️Gesundheitliche Schäden durch Rauchgasinhalation bei Brandeinsätzen | 2.) ⚠️Gehörschäden durch Lärm (Presslufthammer etc.) |
| 3.) ⚠️Stolperfallen durch ungesicherte Kabel an Computern und Druckern | 3.) ⚠️Gefährdung von Menschen in Brandsituationen durch defekte Wasserschläuche, Feuerwehrleitern etc. | 3.) ⚠️Unfallgefahr aufgrund nicht gewarteter Bagger, Kräne etc. |
| 4.) ⚠️Sehbeeinträchtigungen durch lange Bildschirmarbeitszeiten ohne Pausen | 4.) ⚠️Erschwerte Evakuierung und Kommunikationsprobleme ohne klare Rollenverteilungen | 4.) ⚠️Unfallgefahr, wenn Arbeitsabläufe unkoordiniert sind (bspw. zwischen Kranführern und Bodenpersonal) |
| 5.) ⚠️Gefahr, Programme oder Geräte (Computer, Laminiergerät etc.) falsch zu bedienen, wenn Mitarbeiter nicht ausreichend in diese eingewiesen werden | 5.) ⚠️Lebensgefahr für Feuerwehrleute im Einsatz, wenn sie unzureichend im Umgang mit Atemschutzgeräten ausgebildet sind | 5.) ⚠️Gefährdung seiner selbst und anderer Bauarbeiter, wenn der Gerüstbau ohne Unterweisung stattfindet |
| 6.) ⚠️Burnout-Risiko (bspw. durch Termindruck, zu hohes Arbeitspensum etc.) | 6.) ⚠️Risiko von posttraumatischen Belastungsstörungen (traumatische Einsätze etc.) | 6.) ⚠️Unfallgefahr durch Konzentrationsmangel, chronischen Stress, Überstundenarbeit etc. |
Wichtig: Warum ist eine Gefährdungsbeurteilung für die Schwangerschaft einer Mitarbeiterin erforderlich? Genauso wie Schwangere als schützenswerte Personengruppe einen Sonderkündigungsschutz genießen, müssen sie gemäß § 10 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) auch am Arbeitsplatz geschützt werden. Für sie ist deshalb eine separate Prüfung möglicher Gefahren- und Belastungsquellen durchzuführen, sobald sie dem Arbeitgeber signalisiert, dass sie schwanger ist oder ihr bereits geborenes Kind stillt (§ 10 Abs. 2).
Damit die Gefährdungsbeurteilung den Mutterschutz gewährleisten kann, ist der Arbeitgeber verpflichtet, schwangere Arbeitnehmerinnen nur die Aufgaben ausführen zu lassen, für die er zuvor auch die nötigen Anpassungen vorgenommen hat (§ 10 Abs. 3).
FAQ: Gefährdungsbeurteilung
Bei der Gefährdungsbeurteilung (bspw. im Maschinenbau) handelt es sich um einen systematischen Prozess, um die Ursprünge potenzieller Gefährdungen und Belastungen am Arbeitsplatz zu identifizieren. Mehr dazu erfahren Sie an dieser Stelle.
Die Verantwortung für die Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung liegt in der Regel beim Arbeitgeber. Dieser kann aber andere fachkundige Personen (bspw. den Betriebsarzt oder mit Arbeitssicherheit vertraute Fachkräfte) dazu beauftragen. In den Prozess sollten auch die Arbeitnehmer und, sofern vorhanden, der Betriebsrat einbezogen werden.
Die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen lässt sich grundsätzlich in 7 unterschiedliche Schritte aufteilen. Welche das im Detail sind, lesen Sie hier.
Damit eine Gefährdungsbeurteilung vollständig ist, muss der Arbeitgeber in ihr nicht nur klar abgrenzen, um welche Bereiche oder Aufgaben es im Unternehmen jeweils geht. Auch eine Risikobewertung erfasster Gefährdungen darf bspw. nicht fehlen. Das kann von Beruf zu Beruf unterschiedlich sein. In diesem Abschnitt finden Sie einige Beispiele.





Kommentar hinterlassen