Key Facts
- In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Arbeitnehmerrechten, die Arbeitnehmer schützen sollen. Dazu zählen etwa der gesetzliche Urlaubsanspruch oder der Kündigungsschutz.
- Der Arbeitsvertrag regelt nicht nur zentrale Pflichten, sondern auch individuelle Rechte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern.
- Die rechtlichen Grundlagen der Arbeitnehmerrechte sind in verschiedenen Gesetzen verankert, wie etwa im Bürgerlichen Gesetzbuch.
Welche Bedeutung haben Arbeitnehmerrechte?

Inhalt
Der Schutz von Arbeitnehmern ist in Deutschland stark ausgeprägt. Entsprechend umfangreich sind die Rechte für Arbeitnehmer, die zur Absicherung des Arbeitsverhältnisses dienen und Beschäftigten einen gewissen Schutz bieten sollen.
Statt in einem einzigen Gesetz, finden sich die Rechte von Beschäftigten in verschiedenen Gesetzestexten wieder. Doch welche Rechte haben Arbeitnehmer genau in Deutschland?
Im Folgenden werden die wichtigsten Arbeitnehmerrechte aus verschiedenen Bereichen sowie ihre jeweilige gesetzliche Grundlage erläutert.
Der Arbeitsvertrag regelt sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber zentrale Rechte und Pflichten während des Arbeitsverhältnisses. Diese werden durch verschiedene gesetzliche Regelugen ergänzt.
Urlaubsanspruch

Zu den wesentlichen Arbeitnehmerrechten zählt der Urlaubsanspruch.
Gemäß § 1 des Bundesurlaubsgesetzes (BUrlG) hat jeder Arbeitnehmer in Deutschland Anspruch auf bezahlten Urlaub.
Bei einer Fünf-Tage-Woche stehen Beschäftigten gemäß § 3 BUrlG mindestens 20 Urlaubstage pro Kalenderjahr zu. Davon muss der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer mindestens einmal im Jahr zwölf zusammenhängende Urlaubstage gewähren.
Die Regelung greift allerdings erst ab einer Beschäftigungszeit von sechs Monaten gemäß § 4 BUrlG. Arbeitnehmer, die weniger als sechs Monate im Unternehmen beschäftigt sind, haben Anspruch auf einen entsprechenden Teilurlaub.
Zwar kann der Arbeitgeber einem Beschäftigten den Urlaub grundsätzlich nicht verwehren, solange keine dringenden betrieblichen Gründe dagegensprechen. Allerdings muss die Urlaubsplanung trotz geltender Arbeitnehmerrechte vorher mit dem Arbeitgeber abgesprochen werden. Ein Antrag auf Urlaub reicht hingegen nicht aus, um einfach zu Hause zu bleiben.
Kündigungsschutz

Auch der Kündigungsschutz spielt eine wichtige Rolle bei Arbeitnehmerrechten. Rechtsgrundlage dafür bildet das Kündigungsschutzgesetz (KSchG). Es enthält sämtliche Arbeitnehmerrechte zur Kündigung.
Dabei regelt § 1 KSchG, wann eine Kündigung unwirksam ist. Arbeitgeber dürfen nämlich nur dann eine Kündigung aussprechen, wenn diese sozial gerechtfertigt ist.
Besteht das Arbeitsverhältnis des Arbeitgebers länger als sechs Monate und hat der Betrieb mehr als zehn Mitarbeiter, unterliegt er dem allgemeinen gesetzlichen Kündigungsschutz.
In diesem Fall ist eine Kündigung nur dann zulässig, wenn betriebsbedingte, verhaltensbedingte oder personenbezogene Gründe vorliegen – die Kündigung also sozial gerechtfertigt ist.
In der Probezeit bedarf es dagegen keiner bestimmten Gründe, um das Arbeitsverhältnis zu beenden. Außerdem ist die Kündigungsfrist kürzer: Beide Parteien können mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.
Arbeitszeit und Ruhepausen
Neben der Arbeitszeit betreffen Arbeitnehmerrechte die Pausen, Überstunden und die Frage der Erreichbarkeit nach Feierabend. Die Rechtsgrundlage dafür bildet das Arbeitszeitgesetz (ArbZG).

- Arbeitszeit: § 3 ArbZG legt fest, dass die tägliche Arbeitszeit eines Arbeitnehmers acht Stunden nicht überschreiten. Nur in Ausnahmefällen darf die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zehn Stunden erhöht werden. In diesem Fall muss sie jedoch innerhalb eines Ausgleichszeitraum von sechs Monaten im Durchschnitt wieder auf acht Stunden reduziert werden.
- Ruhepausen: Gemäß § 4 ArbZG steht einem Arbeitnehmer eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten pro Tag zu, wenn seine tägliche Arbeitszeit über sechs Stunden beträgt. Arbeitet er gelegentlich über neun Stunden, besteht sogar ein Anspruch auf 45 Minuten Pause. Dabei kann er die Ruhepause auch in mehrere 15-minütige Pausen unterteilen. Zudem stehen dem Arbeitnehmer mindestens elf Stunden ununterbrochene Ruhezeiten zu. In Ausnahmefällen und in manchen Berufen darf die Ruhezeit um eine Stunde reduziert werden. In diesem Fall hat der Arbeitnehmer innerhalb von vier Wochen Anspruch auf einen Ausgleich durch eine verlängerte Ruhepause von mindestens zwölf Stunden gemäß § 5 ArbZG.
- Überstunden: Nur wenn im Arbeitsvertrag oder Tarifvertrag eine entsprechende Regelung für Überstunden getroffen wurde, müssen Arbeitnehmer die zusätzlichen Stunden leisten. Fehlt es an solch einer Regelung, kann der Arbeitnehmer die Überstunden grundsätzlich ablehnen.
Nach Feierabend besteht für Arbeitnehmer keine Pflicht zur Erreichbarkeit. Nur wenn im Dienstplan ausdrücklich eine Bereitschaft vorgesehen ist, müssen sie auch außerhalb der regulären Arbeitszeit erreichbar sein.
Arbeitnehmerrechte ab dem 60. Lebensjahr

Ältere Menschen haben im Rahmen ihrer Arbeitnehmerreche unter Umständen die Möglichkeit, in Altersteilzeit zu gehen.
Dabei handelt es sich um eine Teilzeitbeschäftigung, die durch das Altersteilzeitgesetz (AltTZG) geregelt ist.
Da kein rechtlicher Anspruch auf Altersteilzeit besteht, kann diese jedoch nur aufgrund einer freiwilligen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen.
Möglich ist eine Altersteilzeit nicht erst ab dem 60. Lebensjahr, sondern schon ab einem Alter von 55 Jahren. Voraussetzung ist jedoch, dass der Arbeitnehmer in den letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens 1.080 Kalendertage sozialversicherungspflichtig beschäftigt war.
Die Annahme, dass für ältere Arbeitnehmer ein besonderer Kündigungsschutz gilt, ist falsch. Grundsätzlich hat das Lebensalter keine Auswirkung auf eine Kündigung. Da ältere Arbeitnehmer in der Regel jedoch eine längere Betriebszugehörigkeit haben, sind sie oft aus mehreren Gründen besonders geschützt.
Arbeitsschutz und Gleichbehandlung
Die Rechte der Arbeitnehmer, die den Arbeitsschutz betreffen, sind ausdrücklich im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) geregelt. Gemäß § 4 ArbSchG steht dem Arbeitnehmer das Recht auf eine sowohl physische als auch psychische gesundheitliche Unversehrtheit zu.
Demnach ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, bestimmte Maßnahmen zu ergreifen, die die Gesundheit und Sicherheit des Arbeitnehmers gewährleisten sowie Mobbing oder sexuelle Belästigung unterbinden gemäß § 3 ArbSchG. Dazu gehören unter anderem:
- Unfallvermeidung durch z. B. Schutzvorschriften
- Gefahrenminimierung durch z. B. Vorgaben für die Bedienung von Maschinen
- Gefährdungsbeurteilung
- Schutzmaßnahmen für Beschäftigte, z. B. durch Bereitstellung von Schutzkleidung
- Beurteilung der Arbeitsbedingungen
- Einwirkung von Arbeitsstoffen auf die Gesundheit z. B. Chemikalien
Neben dem Recht auf Arbeitsschutz steht dem Arbeitnehmer auch Gleichbehandlung zu. Das bedeutet, er darf nicht aufgrund seiner Herkunft, seines Geschlechts, seiner Weltanschauung oder seines Lebensstils, einer Behinderung oder seines Alters diskriminiert werden. Rechtsgrundlage dafür ist § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG).
Krankheit
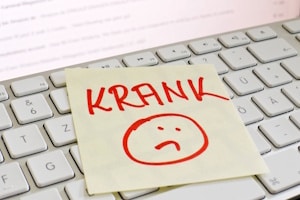
Eines der wichtigsten Arbeitnehmerrechte bei Krankheit stellt der Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall dar.
Rechtsgrundlage ist § 3 des Entgeltfortzahlungsgesetzes (EntgFG).
Meldet sich ein Arbeitnehmer krank, wird er für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit bis zu einer Dauer von sechs Wochen weiterbezahlt.
Voraussetzung ist jedoch, dass er kein Verschulden an der Arbeitsunfähigkeit hat.
Kurzarbeit

Kommt es zu einem erheblichen Ausfall des eigentlichen Arbeitspensums z. B. durch eine schlechte Auftragslage, führen Arbeitgeber häufig Kurzarbeit ein. Doch welche Arbeitnehmerrechte stehen Betroffenen bei Kurzarbeit zu?
Sinn und Zweck der Kurzarbeit ist, Arbeitsplätze trotz vorübergehendem Arbeitsausfall zu erhalten und Arbeitnehmer somit vor der Arbeitslosigkeit zu schützen.
Besonders von Bedeutung für den Arbeitnehmer ist sein Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Dieses soll den Verdienstausfall, der aufgrund der Kurzarbeit entsteht, zumindest teilweise ausgleichen.
Die Höhe des Kurzarbeitergeldes hängt vom jeweiligen Gehalt des Arbeitnehmers ab. In der Regel erhalten Arbeitnehmer 60 Prozent des ausgefallenen Nettogehalts als Kurzarbeitergeld. Beschäftigte mit mindestens einem Kind haben sogar Anspruch auf 67 Prozent des ausgefallenen Nettoeinkommens.
Betriebsübergang
Eines der wichtigsten Arbeitnehmerrechte bei einem Betriebsübergang stellt das Kündigungsverbot dar.

Demnach ist eine Kündigung durch den bisherigen Inhaber oder den neuen Arbeitgeber grundsätzlich unwirksam gemäß § 613a Absatz 4 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), wenn sie aufgrund eines Betriebsübergangs erfolgt.
Nur wenn ein sachlicher Grund für die Kündigung vorliegt, ist diese unter Umständen zulässig.
Steht der Betriebsübergang noch bevor, greift das Kündigungsverbot nur dann, wenn die Tatsachen, die den Betriebsübergang begründen, schon im Zeitpunkt des Kündigungsvorgangs feststehen.
Das Kündigungsverbot wegen des Betriebsübergangs gilt sowohl für die ordentliche sowie außerordentliche Beendigungskündigung als auch für die Änderungskündigung.
Arbeitszeugnis

Gemäß § 109 der Gewerbeordnung (GewO) hat jeder Arbeitnehmer am Ende eines Beschäftigungsverhältnisses das Recht auf ein Arbeitszeugnis – unabhängig davon, ob er selbst kündigt oder ihm die Kündigung ausgesprochen wird.
Dabei kann der Arbeitnehmer selbst entscheiden, ob er ein einfaches Arbeitszeugnis bekommen möchte, das nur die Eckdaten des Arbeitsverhältnisses umfasst, oder ob er ein qualifiziertes Arbeitszeugnis haben möchte, das zusätzlich eine Beurteilung der Leistung und des Verhaltens am Arbeitsplatz enthält.
Elternzeit
Auch Arbeitnehmern in Elternzeit stehen verschiedene Rechte zu. Dabei stellt das sogenannte Rückkehrrecht gemäß § 15 Absatz 5 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) eines der wichtigsten Arbeitnehmerrechte nach der Elternzeit dar.
Die Regelung garantiert Arbeitnehmern, dass sie nach der Elternzeit grundsätzlich zu der Arbeitszeit zurückkehren können, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war. Dies umfasst nicht nur die Art der Tätigkeit, sondern auch den Umfang der Arbeitszeit und die Vergütung. Dabei kann der Arbeitgeber ggf. auch einen gleichwertigen Arbeitsplatz zuweisen.
Mit dieser Regelung will der Gesetzgeber sicherstellen, dass Eltern durch die Betreuung ihrer Kinder keine beruflichen Nachteile erleiden.
Datenschutz

Arbeitgeber erheben während des Arbeitsverhältnisses eine Vielzahl personenbezogener Daten ihrer Mitarbeiter, die einem besonderen Schutz unterliegen.
Unter die Arbeitnehmerrechte im Datenschutz fällt daher insbesondere eine vertrauliche Behandlung und sichere Verwahrung dieser Daten.
Solche Daten können z. B. Informationen in der Personalakte, der Lebenslauf oder das Anschreiben aus dem Bewerbungsprozess des Arbeitnehmers sein.
Arbeitnehmerrechte im Datenschutz sind in der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt und werden durch das in Deutschland geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) konkretisiert.
Minijob

Minijobber gelten nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz als Teilzeitbeschäftigte.
Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes dürfen sie nicht schlechter behandelt werden als vergleichbare Vollzeitbeschäftigte.
Die Arbeitnehmerrechte bei einem Minijob sind daher grundsätzlich die selben wie bei einer Vollzeitbeschäftigung.
FAQ: Arbeitnehmerrechte
Eine gesetzliche Regelung, wie viele Tage Arbeitnehmer am Stück arbeiten dürfen, gibt es nicht. Allerdings regelt das Arbeitszeitgesetz die tägliche Höchstarbeitszeit sowie notwendige Ruhepausen und Ruhetage.
Grundsätzlich haben Menschen in Teilzeit dieselben Rechte wie Arbeitnehmer in Vollzeit gemäß § 4 TzBfG, es sei denn, sachliche Gründe rechtfertigen eine unterschiedliche Behandlung.
Die wichtigsten Arbeitnehmerrechte bei einem Betriebsübergang sind in § 613a BGB geregelt. So gehen bestehende Arbeitsverhältnisse auf den neuen Arbeitgeber über und dürfen im ersten Jahr nach dem Übergang nicht zum Nachteil des Arbeitnehmers geändert werden.



Kommentar hinterlassen