Kurz & knapp: Kündigungsfrist Betriebszugehörigkeit
Die Kündigungsfrist ist in der Regel von der Betriebszugehörigkeit abhängig. Je länger Sie in einem Betrieb arbeiten, desto höher ist auch die gesetzliche Kündigungsfrist. So gelten laut § 622 Abs. 2 nach 2, 5, 8, 10, 12, 15 und 20 Jahren jeweils unterschiedliche Fristen.
Bei einer Kündigung gilt es für den Arbeitgeber stets sowohl auf die Kündigungsfrist als auch auf den Kündigungsschutz zu achten. Außerhalb der Probezeit ist ein Kündigungsgrund notwendig, damit eine Kündigung rechtens ist. Sie können jederzeit unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist kündigen.
Laut Kündigungsschutzgesetz ist die ordentliche Kündigung eines Arbeitsverhältnisses immer mit der Einhaltung einer Kündigungsfrist verbunden. Ganz ohne Kündigungsfrist kann nur eine außerordentliche Kündigung sein. Mehr erfahren Sie hier.
Inhalt

Wie ändert sich die Kündigungsfrist mit der Betriebszugehörigkeit?
Wie lange ist die Kündigungsfrist nach 12 Jahren Betriebszugehörigkeit? Welche Kündigungsfrist gilt nach 20 Jahren? Diese und weitere Fragen kommen bei Arbeitnehmern oftmals auf, wenn es nach einer langen Betriebszugehörigkeit um das Thema Kündigung geht.
Die gesetzliche Kündigungsfrist und die Betriebszugehörigkeit stehen in Korrelation zueinander. Je länger Sie in einem Unternehmen arbeiten, desto höher ist in der Regel auch die Kündigungsfrist.
Die gesetzlich festgelegte Kündigungsfrist liegt grundlegend bei 4 Wochen zum 15. oder Ende eines Monats. Geregelt wird die Kündigungsfrist in § 622 des BGB (Bürgerliches Gesetzbuch).
§ 622 Abs. 1 – Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
Laut § 622 BGB Abs. 2 verändert sich die gesetzliche Kündigungsfrist je nach Betriebszugehörigkeit. So ist die Kündigungsfrist nach 10 Jahre Betriebszugehörigkeit beispielsweise kürzer als nach 15 Jahre Betriebszugehörigkeit. Die Kündigungsfrist steigt so mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit bis zu einem Zeitraum von maximal 7 Monaten an.
Allerdings ändert sich die Kündigungsfrist nicht mit jedem Jahr der Betriebszugehörigkeit, sondern ist entsprechend gestaffelt. Welche Kündigungsfrist bei welcher Betriebszugehörigkeit gilt, sehen Sie in der folgenden Tabelle:
| Betriebszugehörigkeit | Kündigungsfrist |
|---|---|
| nach 2 Jahren | 1 Monat zum Monatsende |
| nach 5 Jahren | 2 Monate zum Monatsende |
| bei 8 Jahren | 3 Monate zum Monatsende |
| nach 10 Jahren | 4 Monate zum Monatsende |
| nach 12 Jahren | 5 Monate zum Monatsende |
| bei 15 Jahren | 6 Monate zum Monatsende |
| bei 20 Jahren | 7 Monate zum Monatsende |
| nach 25 Jahren | 7 Monate zum Monatsende |
| nach 30 Jahren | 7 Monate zum Monatsende |
| nach 40 Jahren | 7 Monate zum Monatsende |
Die maximale Kündigungsfrist laut Gesetz ist somit nach insgesamt 20 Jahren erreicht. Dementsprechend beträgt die gesetzliche Kündigungsfrist auch bei längerer Betriebszugehörigkeit maximal 7 Monate.
Kündigungsfrist für Arbeitnehmer: Ist die Betriebszugehörigkeit relevant?

Welche Kündigungsfristen gelten, regelt das Bürgerliche Gesetzbuch. Zwar ist für die Kündigungsfrist vom Arbeitgeber die Betriebszugehörigkeit entscheidend, allerdings gilt dies nicht für den Arbeitnehmer.
Bei Arbeitnehmern findet lediglich § 622 Abs. 1 BGB Anwendung, sodass für die Berechnung der Kündigungsfrist die Arbeitnehmer-Betriebszugehörigkeit und damit auch die steigenden Fristen laut Absatz 2 des Gesetztes irrelevant sind.
Unabhängig von der Betriebszugehörigkeit beträgt die Kündigungsfrist für den Arbeitnehmer somit 4 Wochen zum 15. oder Ende eines Monats. Diese Kündigungsfrist gilt auch bei langer Betriebszugehörigkeit und ändert sich nicht. So ist für Arbeitnehmer eine Kündigung nach einer Betriebszugehörigkeit von 20 oder 30 Jahren ebenfalls mit einer Frist von lediglich 4 Wochen möglich.
Wann für Arbeitnehmer die Betriebszugehörigkeit wichtig ist
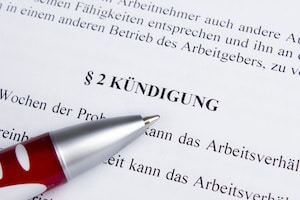
Abweichend von der gesetzlichen Frist von 4 Wochen gibt es einige Sonderfällen, in denen sich andere Fristen vereinbaren lassen. Hierzu zählen beispielsweise Vereinbarungen im Arbeitsvertrag oder geltende Tarifverträge, sofern diese im Tätigkeitsbereich Anwendung finden. Gilt die gesetzliche Kündigungsfrist, kann für Arbeitnehmer aber die Betriebszugehörigkeit wichtig werden.
Bei einer Kündigung kommt trotz der gesetzlich festgelegten Kündigungsfristen häufiger die Frage auf, ob eine Kündigungsfrist unabhängig von der Betriebszugehörigkeit für Arbeitnehmer auch länger ausfallen kann.
Laut § 622 BGB gibt es verschiedene Ausnahmen, durch die andere Kündigungsfristen für den Arbeitnehmer bestehen können. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie mit Ihrem Arbeitgeber eine gesonderte Vereinbarung zur Kündigungsfrist in Ihrem Arbeitsvertrag vereinbaren.
So ist es beispielsweise möglich, im Arbeitsvertrag zu vereinbaren, dass die gesetzlichen Kündigungsfristen aus § 622 Abs. 2 BGB auch für den Arbeitnehmer gelten. In diesem Fall richtet sich auch für Sie die Kündigungsfrist nach der Betriebszugehörigkeit. Auch längere Kündigungsfristen lassen sich vereinbaren. Hierbei darf die Kündigungsfrist vom Arbeitnehmer jedoch niemals höher als die Frist für den Arbeitgeber sein.
§ 622 Abs. 6 – Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber.
Ebenso ist es möglich, im Arbeitsvertrag kürzere Kündigungsfristen zu vereinbaren. Dies ist jedoch lediglich arbeitnehmerseitig möglich. Für Arbeitgeber bleiben die gesetzlichen Kündigungsfristen bestehen, auch wenn in arbeitsvertragliche Vereinbarungen etwas anderes steht.
Für Arbeitgeber sind somit ausschließlich längere Kündigungsfristen möglich. Hierbei handelt es sich um das sogenannte Günstigkeitsprinzip, welches dafür sorgt, dass die Abweichung ausschließlich zugunsten des Arbeitnehmers erfolgen darf.
Eine Ausnahme hiervon besteht laut Absatz 5 des Gesetzes jedoch für kurzzeitig Beschäftigte, die nicht länger als 3 Monate angestellt sind, und für Unternehmer, die weniger als 20 Arbeitnehmer beschäftigen. In diesem Fall gilt eine Kündigungsfrist von mindestens 4 Wochen.
Welche Auswirkungen haben Tarifverträge auf die Kündigungsfrist?

Ähnlich wie bei den arbeitsvertraglichen Vereinbarungen können auch in Tarifverträgen andere Kündigungsfristen enthalten sein. Im Gegensatz zum Arbeitsvertrag stehen Regelungen im Tarifvertrag jedoch über den gesetzlichen Bestimmungen.
Es ist beispielsweise auch möglich, dass durch einen Tarifvertrag verkürzte Kündigungsfristen im Vergleich zu § 622 BGB gelten. Ein Beispiel hierfür ist unter anderem der Bundesrahmentarifvertrag für das Baugewerbe.
Dieser wurde im Jahr 2018 eingeführt und sieht vor, dass die arbeitnehmer- und arbeitgeberseitige Kündigungsfrist innerhalb der ersten 3 Jahre lediglich 12 Tage beträgt. Ab einer Betriebszugehörigkeit von 3 Jahren steigt die Kündigungsfrist in diesem Beispiel auf 1 Monat zum Monatsende. Anschließend gilt wieder die gesetzliche Kündigungsfrist je nach Zugehörigkeit.
Wie verhält es sich mit der Kündigungsfrist in der Probezeit?
Bei der Probezeit handelt es sich um eine Art Orientierungsphase, die dazu dient, sich gegenseitig kennenzulernen. Sie als Arbeitnehmer können in diesem Zeitraum herausfinden, ob die neue Tätigkeit und das jeweilige Unternehmen zu Ihnen passen. Für Arbeitgeber dient dieser Zeitraum dazu, um zu überprüfen, ob der neue Mitarbeiter den Anforderungen und Vorstellungen entspricht.
Laut § 622 Abs. 3 BGB darf die Probezeit maximal 6 Monate betragen. Innerhalb der vereinbaren Zeit besteht ein gelockerter Kündigungsschutz. So ist es beispielsweise dem Arbeitgeber möglich, eine Kündigung auszusprechen, ohne einen entsprechenden Grund nennen zu müssen.
Zusätzlich gilt in der Probezeit eine verkürzte Kündigungsfrist. Das Arbeitsverhältnis lässt sich in diesem Zeitraum mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Eine Bindung des Kündigungsdatums an den 15. oder an das Ende eines Monats besteht nicht.
Welche Kündigungsfristen gelten im Minijob?

Bei einem Minijob handelt es sich um eine laut Arbeitsrecht geringfügig entlohnte Beschäftigung mit einem monatlichen Verdienst von maximal 520 Euro. Auf ein ganzes Jahr gerechnet ergibt sich ein maximales Einkommen von 6.240 Euro. Im Gegensatz zu einem Teilzeitjob ist ein Minijob nicht sozialversicherungspflichtig.
Beim Kündigungsschutz und den Kündigungsfristen gibt es hingegen keine Unterschiede zu einer Teilzeit- oder Vollzeitanstellung. Dementsprechend ist nach der Probezeit für eine ordentliche Kündigung ein Grund notwendig und es gilt die jeweilige Kündigungsfrist einzuhalten. So ist für die Kündigungsfrist im Minijob die Betriebszugehörigkeit ebenfalls entscheidend.
Wie bei anderen Arbeitnehmern auch, steigt diese mit der Betriebszugehörigkeit an und es gelten dieselben Fristen wie bei einer normalen Beschäftigung, auch für den Mitarbeiter. In der Praxis halten sich jedoch nur wenige Unternehmen oder Arbeitnehmer an die gesetzlichen Regelungen.
Besteht ein Abfindungsanspruch nach einer langen Betriebszugehörigkeit?

Ein gesetzlicher Abfindungsanspruch besteht ausschließlich bei einer betriebsbedingten Kündigung. Und auch hier ist dieser nicht pauschal gesichert, sondern an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, die erfüllt werden müssen. Ein automatischer Abfindungsanspruch besteht also nie, egal wie lange Sie in einem Betrieb tätig sind oder waren.
Die Voraussetzungen für einen gesetzlichen Abfindungsanspruch sind in § 1a des Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) festgelegt. Hier heißt es:
Kündigt der Arbeitgeber wegen dringender betrieblicher Erfordernisse nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und erhebt der Arbeitnehmer bis zum Ablauf der Frist des § 4 Satz 1 keine Klage auf Feststellung, dass das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst ist, hat der Arbeitnehmer mit dem Ablauf der Kündigungsfrist Anspruch auf eine Abfindung.
Hierfür ist wiederum Bedingung, dass der Arbeitgeber im Kündigungsschreiben eine entsprechende Abfindung nennt. Ist dies nicht der Fall und Sie empfinden die Kündigung als sozial ungerechtfertigt, können Sie innerhalb einer Woche Einspruch gegen die Kündigung beim Betriebsrat einreichen.
Gibt es bei Ihrem Arbeitgeber keinen Betriebsrat, sollten Sie gemäß § 4 KSchG innerhalb einer Frist von 3 Wochen nach Erhalt der Kündigung Klage beim Arbeitsgericht einreichen. Kontaktieren Sie hierzu am besten direkt nach dem Erhalt Ihrer Kündigung einen Rechtsanwalt. Die entstehenden Anwaltskosten deckt in der Regel Ihre Rechtsschutzversicherung ab.
Kommt es zu einem Kündigungsschutzprozess, entscheidet das Arbeitsgericht über die Rechtmäßigkeit der Kündigung. Fällt das Urteil zu Ihren Gunsten aus, wird die Kündigung unwirksam. Ihr Arbeitsvertrag gilt somit als ungekündigt und besteht weiterhin fort.
Dies hat zur Folge, dass Ihr Arbeitgeber Sie nicht nur wieder beschäftigen muss, sondern Ihnen auch Ihr Gehalt für den Zeitraum zwischen dem Kündigungsdatum und dem Ende des Gerichtsverfahrens schuldet.
Ist dies nicht möglich oder nicht gewünscht, spricht das Gericht Ihnen in der Regel eine Abfindung zu. Hierzu richtet sich die Rechtssprechung oftmals an den in § 1a des Kündigungsschutzgesetzes genannten Abfindungsanspruch in Höhe von einem halben Bruttomonatsgehalt pro Beschäftigungsjahr.



Kommentar hinterlassen