Key Facts
- Der gesetzliche Kündigungsschutz greift erst, wenn das Arbeitsverhältnis eines Arbeitnehmers mindestens sechs Monate bestanden hat gemäß § 1 Abs. 1 KSchG – dieser Zeitraum wird auch als Wartezeit bezeichnet.
- Frühere Beschäftigungen im selben Betrieb können auf die Wartezeit angerechnet werden, wenn ein enger zeitlicher und sachlicher Zusammenhang zwischen beiden Arbeitsverhältnissen besteht.
- Die gesetzlich festgelegte Wartezeit entspricht nicht der individuell vereinbarten Probezeit im Arbeitsrecht.
Grundlagen: Was ist die Wartezeit im Arbeitsrecht?

Inhalt
Der Begriff Wartezeit bezeichnet im Arbeitsrecht den Zeitraum, der vergehen muss, bevor bestimmte Rechte und Ansprüche entstehen. So gibt es unter anderem eine:
- Wartezeit im Kündigungsschutzgesetz
- Wartezeit beim Urlaubsanspruch
- Wartezeit bei Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
Auch im Sozialrecht spielen Wartezeiten eine Rolle, z. B. für die Inanspruchnahme von bestimmten Leistungen aus der Sozialversicherung.
Es gibt jedoch auch Ansprüche im Arbeitsrecht, die ohne Wartezeit entstehen. Sie ergeben sich aus dem Gesetz oder dem Arbeitsvertrag. Dazu zählt etwa der Anspruch auf Mindestlohn oder Gehalt.
Wartezeit im Kündigungsschutzgesetz

Die wohl bekannteste und wichtigste Wartezeit im deutschen Arbeitsrecht ist die Wartezeit bei einer Kündigung, welche in § 1 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz (KSchG) geregelt ist.
Demnach greift der gesetzliche Kündigungsschutz eines Arbeitnehmers erst dann, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate bestanden hat.
Innerhalb dieser Zeit kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis jederzeit ohne Angaben von Gründen kündigen.
Während nachteilige Vereinbarungen als unwirksam gelten, sind abweichende Vereinbarungen zugunsten des Arbeitnehmers – wie die Verkürzung oder der Ausschluss der Wartezeit – nach dem Kündigungsschutzgesetz zulässig sind.
Berechnung der Wartezeit im Kündigungsschutzgesetz
Maßgeblich für die Berechnung der Wartezeit ist der rechtliche Beginn des Arbeitsverhältnisses und nicht die Dauer der tatsächlichen Beschäftigung.
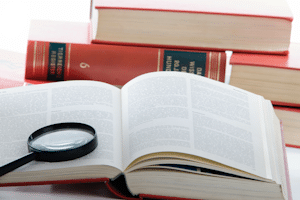
- Beginn der Wartezeit: Die Wartezeit beginnt mit der tatsächlichen Arbeitsaufnahme – also nicht mit Unterzeichnung des Arbeitsvertrags. Wird der Arbeitsvertrag etwa am 01. Dezember geschlossen, der Arbeitsantritt ist allerdings erst am 01. Januar des Folgejahres, so beginnt die Wartezeit am 01. Januar. Bei einem Betriebsübergang wird die beim bisherigen Betrieb erbrachte Wartezeit angerechnet.
- Ende der Wartezeit: Besteht das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate in demselben Unternehmen, ist die Wartezeit erfüllt. Der Tag, an dem das Arbeitsverhältnis beginnt, wird bei der Berechnung der Frist mitgezählt gemäß § 187 Absatz 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Die Wartezeit endet mit dem Tag des letzten Monats, der vor dem Anfangstag liegt. Erfolgt der Arbeitsantritt etwa am 01. Januar, endet die Wartezeit mit Ablauf des 30. Juni.
- Unterbrechung der Wartezeit: Grundsätzlich wird die Wartezeit durch jede rechtliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses unterbrochen. Erfolgt die Unterbrechung jedoch nur kurz und auf Veranlassung des Arbeitgebers wird die Wartezeit fortgerechnet. Das gilt auch, wenn der Arbeitnehmer während der Wartezeit verschiedene Tätigkeiten ausübt und ein enger sachlicher Zusammenhang zwischen beiden Arbeitsverhältnissen besteht. Eine feste Höchstdauer für die Unterbrechung gibt es nicht – je länger sie dauert, desto stärker muss der sachliche Zusammenhang sein.
Wartezeit im Kündigungsschutzgesetz: Wird eine Vorbeschäftigung angerechnet?

Nach § 1 Absatz 1 KSchG gilt der Kündigungsschutz nur für einen Arbeitnehmer
[…] dessen Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat […].
Nach der Rechtsprechung kann eine frühere Beschäftigung im selben Betrieb jedoch unter bestimmten Voraussetzungen auf die Wartezeit angerechnet werden. Entscheidend ist, dass zwischen dem neuen und alten Arbeitsverhältnis ein enger zeitlicher und sachlicher Zusammenhang besteht.
Eine feste Höchstdauer, wie lang eine Unterbrechung sein darf, ist allerdings nicht bestimmt.
Gibt es keine zeitliche Unterbrechung, wird immer von einem ununterbrochenen Arbeitsverhältnis ausgegangen – unabhängig davon, ob ein sachlicher Zusammenhang besteht oder nicht.
Eine vollständige Anrechnung der Wartezeit erfolgt beispielsweise dann, wenn ein Auszubildender nach Ende seines Ausbildungsverhältnisses übernommen wird – in der Regel genießt er ab dem ersten Arbeitstag vollen Kündigungsschutz. Auch bei einem Werkstudenten, der übernommen wird, erfolgt eine Anrechnung der Wartezeit, sofern für das neue Arbeitsverhältnis ein enger zeitlicher und sachlicher Zusammenhang besteht.
Unterschied zwischen Wartezeit und Probezeit

Probezeit und Wartezeit sind im Kündigungsschutzgesetz nicht das gleiche.
Im Gegensatz zur gesetzlich festgelegten Wartezeit wird die Probezeit individuell vereinbart. Sie kann sich z. B. auf drei oder maximal sechs Monate erstrecken. Häufig ist sie identisch mit der gesetzlichen Wartezeit, kann allerdings ebenso davon abweichen.
Auch nach Ablauf der Probezeit kann der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ohne Angaben von Gründen kündigen. Allerdings verlängert sich die Kündigungsfrist dann von zwei auf vier Wochen gemäß § 622 Absatz 1 BGB.
FAQ: Wartezeit im Kündigungsschutzgesetz
Die gesetzliche Wartezeit bezeichnet im Arbeitsrecht die Zeitspanne, die nach Beginn eines Arbeitsverhältnisses verstreichen muss, bevor bestimmte Rechte und Ansprüche entstehen
Während der Wartezeit von sechs Monaten gelten grundsätzlich die gesetzlichen Kündigungsfristen oder vertraglich vereinbarte abweichende Fristen. Die gesetzliche Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum 15. oder zum Ende des Kalendermonats.
Die Probezeit wird individuell vereinbart und kann beispielsweise drei oder maximal sechs Monate betragen, während die Wartezeit hingegen gesetzlich festgelegt ist.



Kommentar hinterlassen